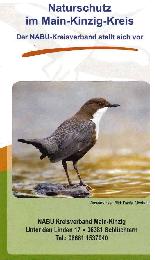NABU im Main-Kinzig-Kreis trauert um Sibylle Winkel
Der NABU im Main-Kinzig-Kreis trauert um Sibylle Winkel, welche viel zu früh im Alter von 64 Jahren verstarb.
Als Diplom Biologin beschäftigte sich Sibylle , getreu ihrem Motto „unseren Nachfahren eine lebenswerte Welt erhalten“ in vielfältiger Weise beim NABU Main-Kinzig-Kreis.
Ihr Engagement beim NABU, der sich heute für Biotope und Artenschutz, gesunde Luft, sauberes Wasser und den schonenden Umgang mit endlichen Ressourcen einsetzt, hat Spuren hinterlassen.
Über lange Jahre war Sibylle Vorstandsmitglied des NABU-Kreisverbandes, davon viele Jahre als CO-Vorsitzende.
Ganz besonders wichtig war ihr der Erhalt der Amphibien und Reptilien. Insbesondere der Schutz der europäischen Sumpfschildkröte war ihr eine Herzensangelegenheit. Seit 1998 setzte sie sich für die Vermehrung und Auswilderung von jungen Schildkröten in Hessen und angrenzenden Bundesländern ein.
Aufgrund ihrer umfangreichen Kenntnisse war Sibylle eine gefragte Gesprächspartnerin für viele Naturschutzgruppen. Für den behördlichen Naturschutz, auch über die Grenzen des Main-Kinzig-Kreises hinaus, war sie eine anerkannte und geschätzte Ansprechpartnerin.
Mit ihr verliert der Naturschutz eine starke Mitstreiterin!
Kerb beim NABU Großkrotzenburg
Am Freitag, 08. September ab 17:00 Uhr!
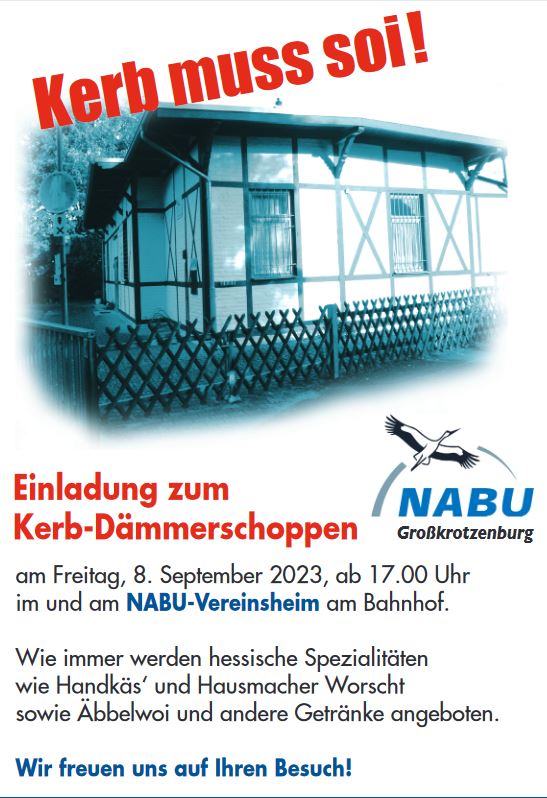
Foto: NABU